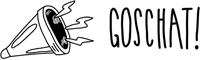Fast Fashion: „Demokratisierung der Mode“?
Fast Fashion hat in den letzten Jahrzehnten die Welt erobert. Jede:r kennt Marken wie H&M, Zara oder Shein. Doch haben sie mit ihren niedrigen Preisen wirklich zur „Demokratisierung der Mode“ beigetragen? Oder ist das alles eine Lüge, um Konsument:innen zu gewinnen?
Spätestens seit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch wissen wir alle, dass es in der Modeindustrie nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Das Unglück löste weltweit eine Diskussion zu Sicherheit und Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion aus. Man begann auch, sich kritisch mit dem System von „Fast Fashion“ auseinanderzusetzen.
Die Entstehung von Fast Fashion
„Fast Fashion“ hat seine Anfänge in den 1980er Jahren. Der Begriff bezeichnet ein Geschäftsmodell der Modeindustrie, bei dem Kollektionen schnell und nach den neuesten Trends designt werden. Diese werden dann in großen Mengen und zu niedrigen Preisen produziert und verkauft.
Nach der Jahrtausendwende begannen Unternehmen ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Die Gesetzeslage in diesen Ländern erlaubt es ihnen immer schneller und noch billiger zu produzieren. Heute spricht man von „Ultra Fast Fashion“. Marken wie Shein produzieren fast täglich massenhaft und billig neue Stücke, um sie für wenige Euros auf ihren Webseiten anzubieten.
Anfangs bezeichneten einige diese Entwicklung als „Demokratisierung der Mode“. Durch die billigen Preise wurde trendige Mode für alle zugänglich. Eine Aussage, der man im ersten Moment zustimmen könnte, findet Jana (21). „Wenn ich jetzt aber genauer darüber nachdenke, stimmt das nicht. Demokratie sollte eigentlich für alle da sein und alle sollten davon profitieren. Bezieht man da jetzt die Arbeiter:innen mit ein, ist das sicher nicht mehr der Fall. Es profitieren also hauptsächlich die westlichen Industrieländer von dem System.“
Der Preis der Billigmode
In der Modeindustrie sind etwa 70 Millionen Menschen beschäftigt. Davon verdient nur ein Bruchteil genug, um sich ein angemessenes Leben leisten zu können. „Sieht so Demokratie aus?“, fragt sich Jana.
Dabei wäre ein existenzsichernder Lohn ein von den Vereinigten Nationen anerkanntes Menschenrecht. Er soll ausreichen, um den Arbeiter:innen und ihren Familien ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Essen, Wohnen, Gesundheitsvorsorge, Bildung, Kleidung, Transport und Ersparnisse müssen damit abgedeckt werden. Damit nicht zu verwechseln ist der Mindestlohn. Dieser wird von den Gesetzgeber:innen der einzelnen Länder festgelegt und liegt meist weit unter dem Existenzlohn. Laut der Initiative The Industry We Want liegt die Kluft zwischen dem durchschnittlichen Lohn und dem existenzsichernden Lohn in der Bekleidungs- und Schuhindustrie bei 45 Prozent. Die Arbeiter:innen verdienen also knapp die Hälfte von dem, was sie tatsächlich brauchen.
Exkurs: Modeindustrie & Umwelt
Die Modeindustrie belastet nicht nur das Klima, sondern trägt auch stark zur Umweltverschmutzung bei.
Durch die enormen Produktionsmengen entsteht viel Müll. Laut der Ellen MacArthur Foundation wird pro Sekunde ein LKW voller Textilien deponiert oder verbrannt.
Der CO2-Ausstoß betrug im Jahr 2018 rund 2,1 Milliarden Tonnen. Das sind etwa 4% der Globalemissionen oder so viel wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien jährlich zusammen ausstoßen.
Durch Kleidung gelangen jedes Jahr eine halbe Million Tonnen Mikrofasern ins Meer, was mehr als 50 Milliarden Plastikflaschen entspricht.
Faire Mode hat (auch) seinen Preis
„Das ganze System ist einfach nicht richtig“, findet Isabel (24). Klar würde sie lieber Kleidung kaufen, die unter guten Bedingungen produziert wurde. Aber das sei für sie im Moment leider einfach zu teuer. „Ich kaufe aber nur etwas, wenn ich es wirklich brauche. Also kaufe ich sehr selten neue Kleidung.“ Auch Jana sieht das so. „Als Student:in kann man sich das nicht wirklich leisten. Wenn man dann einen Job hat, kann sich das natürlich ändern“. Für den Moment kauft sie aber lieber weniger und trägt die Stücke dafür länger. Die hohen Preise schließen also viele Konsument:innen vom Kauf aus.
Mona Heiß, die selbst nachhaltige Unterwäsche produziert, entgegnet dem: „Es gibt auch Mode, die nicht nachhaltig und sehr teuer ist“. Handarbeit und Nachhaltigkeit sei oft teurer oder zumindest gleich teuer wie konventionelle Mode, bestätigt die junge Designerin. „Das hat aber oft auch damit zu tun, dass gerade kleinere Unternehmen nicht diese Produktionsvolumen [wie große Unternehmen] haben und deswegen nicht so günstig produzieren können.“
Für sie sei es aber trotzdem wichtig und notwendig die Arbeiter:innen wertzuschätzen und fair zu bezahlen – auch wenn dadurch die Preise für die Kund:innen steigen. Mona Heiß findet, „wenn man weniger Kleidung hat und dafür hochwertigere, kommt es im Endeffekt gar nicht teurer“. Auf lange Sicht zahlt es sich also aus, weniger aber dafür – sowohl hinsichtlich Produktionsverhältnissen als auch Qualität – bessere Kleidung zu kaufen.
Fast Fashion kaufen = Schlechter Mensch?
Ist man nun ein schlechter Mensch, wenn man Fast Fashion Mode kauft? Die klare Antwort unserer Interviewpartner:innen: Nein, niemand ist ein „schlechter Mensch“, weil er:sie Fast Fashion Mode kauft. „Ich glaube man muss dann vielleicht unterscheiden zwischen den Menschen, die sonst keine andere Möglichkeit haben und denjenigen, die eine Wahl haben“, so Romana (26). Man könne den Konsument:innen aber nicht die Schuld am System geben.
Als Konsument:in kann man aber auch einiges bewirken. Neben einem bewussteren Konsum, sollte man auch die Gesetzgeber:innen und die Unternehmen zu mehr Verantwortung aufrufen.
Aus diesem Gedanken heraus ist auch die Europäische Bürger:inneninitiative „Good Clothes Fair Pay“ entstanden. Die Initiative fordert von der Europäischen Kommission Gesetze, die für Textil- und Bekleidungsarbeiter:innen weltweit einen existenzsichernden Lohn gewährleisten. Ab dem 19. Juli kann jede:r wahlberechtigte EU-Bürger:in die Initiative unterzeichnen.
Wenn man also von einer „Demokratisierung der Mode“ spricht, sind das nicht niedrige Preise, die sich auf Umweltzerstörung und Ausbeutung stützen. Von einer „Demokratisierung“ kann man erst sprechen, wenn alle von der Mode profitieren – jene, die sie tragen und jene, die sie herstellen.
Titelbild: Sale von markusspiske CC0 Pixabay